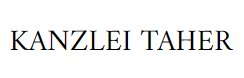Der Ablauf eines Strafverfahrens
Das Strafverfahren dient zur Feststellung einer Straftat und zur Festsetzung von Sanktionen und Strafen. Das Strafverfahren ist wie folgt aufgebaut:
- Ermittlungsverfahren
- Zwischenverfahren
- Hauptverfahren
- Rechtsmittel (Berufung/Revision)
- Strafvollstreckungsverfahren
Ermittlungsverfahren
Jedes Strafverfahren beginnt mit dem Ermittlungsverfahren. Das bedeutet, dass die Ermittlungsbehörden beispielsweise durch eine Anzeige Kenntnis vom Verdacht einer Straftat erlangen und ein sogenannter Anfangsverdacht gem. §152 II StPO vorliegt. Die Ermittlungsbehörden sind in solchen Fällen verpflichtet, dem Sachverhalt nachzugehen.
Bei den Untersuchungen müssen nicht nur belastende, sondern auch den Beschuldigten entlastende Umstände ermittelt werden (§160 II StPO). In der Praxis sieht das allerdings anders aus, hier fehlt es häufig an der Objektivität der Ermittlungen. Denn Ermittlungsbeamte haben oftmals ein gefährliches Interesse, Ermittlungen schnell und „erfolgreich“ abzuschließen. Dann bleiben entlastende Umstände häufig auf der Strecke.
Da die Staatsanwaltschaft den weiteren Ablauf der Ermittlungen lenkt, erhält diese dann den Sachverhalt von der Polizei – und damit oftmals erstmalig überhaupt Kenntnis von den tatsächlichen Ermittlungen.
Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob ein hinreichender Tatverdacht, der zur Anklageerhebung oder einem Strafbefehl führt, vorliegt. Wird dem zuständigen Staatsanwalt ein nur einseitig beleuchteter Sachverhalt präsentiert, wird er dazu neigen, Anklage zu erheben.
Hier können Gefahren für den Beschuldigten lauern. Denn der anwaltlich nicht vertretene Beschuldigte ist dem einseitigen Vorgehen der Ermittlungsbehörden schutzlos ausgeliefert.
Als Beschuldigter erhalten Sie über eine Vorladung darüber Kenntnis, dass gegen Sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist.
Wichtig: Einer polizeilichen Vorladung als Beschuldigter müssen und sollten Sie niemals ohne vorherige anwaltliche Beratung folgen.
Ein Gespräch mit der Polizei kann u.U. sogar – ohne dass Sie es merken – den Tatverdacht gegen Sie erhärten!
Demnach ist es ratsam, dass ein Strafverteidiger zunächst Akteneinsicht beantragt, um die Akte intensiv studieren zu können. Danach kann ein Strafverteidiger mit Ihnen eine Strategie ausarbeiten, wobei eine Einlassung hier immer noch erfolgen kann, sofern dies sinnvoll ist. Je früher Sie einen versierten Strafverteidiger beauftragen, umso höher sind die Chancen eine Hauptverhandlung zu verhindern.
Sollten Sie Beschuldigter eines Strafverfahrens sein, zögern Sie nicht und kommen Sie auf mich zu. Als Fachanwältin für Strafrecht stehe ich Ihnen mit jahrelanger Expertise mit Rat und Tat zur Seite. Vereinbaren Sie gerne online oder telefonisch einen Termin.
Anklage – Zwischenverfahren
Sollten ausreichend Beweise für die Begehung der Straftat vorliegen, wird die Staatsanwaltschaft Anklage erheben. Mit Eingang der Anklageschrift bei Gericht ist das Zwischenverfahren eröffnet.
Jetzt gilt es, die Hauptverhandlung zu verhindern.
Sinn und Zweck des Zwischenverfahrens ist die nochmalige Überprüfung der Frage, ob ein hinreichender Tatverdacht vorliegt und ob ein Hauptverfahren durchgeführt wird.
Die Prüfung erfolgt durch das Gericht. Das Gericht ist dabei dasselbe Gericht, welches später eine etwaige Hauptverhandlung durchführt. Sollte es also zu einer Hauptverhandlung kommen, hat dasselbe Gericht vorab bereits einen hinreichenden Tatverdacht und damit „die Wahrscheinlichkeit der Verurteilung“ festgestellt (§ 203 StPO).
Die Nichteröffnung des Hauptverfahrens ist noch möglich!
Lassen Sie es im besten Fall erst gar nicht so weit kommen und zögern Sie nicht, einen Strafverteidiger zu kontaktieren. Dieser kann vor allem rechtliche Einwände gegen die Anklage erheben.
Ihr Strafverteidiger kann einen Antrag auf Nichteröffnung der Hauptverhandlung bei Gericht stellen. So kann oftmals ganz oder teilweise die Eröffnung des Hauptverfahrens verhindert werden (§ 204 StPO).
Im Zwischenverfahren gibt es daneben noch die Möglichkeiten der Einstellung des Verfahrens.
Einstellung des Verfahrens
Sollten aus Sicht der Verteidigung keine hinreichenden Beweise vorliegen, welche die Erhebung einer Anklage rechtfertigen, wird sie die Einstellung des Verfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts nach § 170 Abs. 2 StPO beantragen.
Häufig kommt auch eine Einstellung aufgrund geringer Schuld nach § 153 Abs. 1 StPO in Betracht (z. B. bei Ersttätern oder weniger schwerwiegenden Vergehen wie Diebstahl). Wenn dem Antrag stattgegeben wird, ist das Verfahren ohne Schuldspruch und ohne Auflagen abgeschlossen.
Es besteht auch die Möglichkeit einer Einstellung gegen eine Auflage gemäß § 153 a Abs. 2 StPO (z.B. Zahlung eines Geldbetrages, Ableisten von Sozialstunden). Eine solche Einstellung setzt die Zustimmung des Beschuldigten voraus, welche jedoch nicht als Schuldeingeständnis zu verstehen ist. Der Beschuldigte kann sich also gemäß der Unschuldsvermutung weiterhin als unschuldig bezeichnen. Erfüllt der Beschuldigten die Auflagen, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Das bedeutet, dass die Tat auch später nicht verfolgt werden kann, es sei denn, es stellt sich heraus, dass der Sachverhalt ein Verbrechen und nicht nur ein Vergehen begründet. Vorteil dieser Einstellung ist, dass keine Eintragung im polizeilichen Führungszeugnis oder im Bundeszentralregister erfolgt.
Kommt eine der o.g. Einstellung nicht in Betracht oder hat ein Antrag auf Nichteröffnung der Hauptverhandlung keine Aussicht auf Erfolg, ist die Hauptverhandlung vorzubereiten.
Ihre Verteidigung trägt alle Argumente zur Einstellung/Nichteröffnung der Hauptverhandlung vor.
Nutzen Sie also die Verteidigung bereits im Ermittlungsverfahren, um auszuloten, ob eine der genannten Einstellungsmöglichkeiten in Betracht kommt und eine Hauptverhandlung verhindert werden kann.
Hauptverfahren
Sofern das Gericht die Anklage zulässt, also das Hauptverfahren eröffnet, werden ein oder mehrere Termine anberaumt.
Ein guter Strafverteidiger wird die Akte durcharbeiten, die Hauptverhandlung aktiv mitgestalten und Sie durchgehend über Ihre Chancen und Möglichkeiten beraten und aufklären.
- Ablauf einer Hauptverhandlung – kurz und verständlich:
- Aufruf der Sache
- Vernehmung des Angeklagten zur Person
- Verlesung der Anklageschrift durch den Staatsanwalt
- Vernehmung des Angeklagten zur Sache
- Beweisaufnahme (Zeugenvernehmung, Inaugenscheinnahme,…)
- Schlussvorträge: Die Staatsanwaltschaft hält Ihren Schlussvortrag. In der Regel beantragt sie eine Strafe. Anschließend folgt das Plädoyer der Verteidigung. Der Angeklagte erhält das letzte Wort, § 258 II StPO.
- Anschließend zieht sich das Gericht zur geheimen Beratung zurück
- Urteilsverkündung
- Berufung im Strafrecht
- Jedes Urteil eines Amtsgerichts ist grundsätzlich mit dem Rechtsmittel der Berufung anfechtbar, § 312 StPO.
- Oft gibt es gute Gründe, Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil einzulegen. Zum Einen ist es möglich, dass sich neue Beweise finden, die zur Entlastung beitragen. Zum Anderen ist der Verurteilte mit der Auswertung der Beweise seitens des Gerichts oder mit der Art und Höhe der Strafe nicht zufrieden.
Das Verschlechterungsverbot
Gemäß § 331 Abs. 1 StPO gilt das sogenannte Verschlechterungsverbot. Sofern der Angeklagte Berufung eingelegt hat, darf das Urteil danach grundsätzlich nicht zu seinem Nachteil geändert werden.
Achtung: Das Rechtsmittel der Berufung kann auch durch die Staatsanwaltschaft eingelegt werden. Sollte dies der Fall sein, (z.B. weil sie das Urteil für den Angeklagten zu milde hält), ist eine Verschlechterung möglich!
Frist für die Einlegung der Berufung
Die Frist zur Einlegung der Berufung beträgt eine Woche. Die Frist beginnt bereits ab der Urteilsverkündung, also in der Regel dem letzten Tag der Hauptverhandlung. Sollten Sie gegen ein erstinstanzliches Urteil Berufung einlegen wollen, ist Eile geboten.
Kontaktieren Sie dann sofort einen Strafverteidiger!
Berufung – letzte Chance
Die Berufung ist mitunter die letzte Chance! Nach Einlegung der Berufung erfolgt die Berufungshauptverhandlung am Landgericht. Sofern Sie vom Landgericht wieder verurteilt werden, steht Ihnen das Rechtsmittel der Berufung nicht mehr zur Verfügung! Es kann dann nur noch Revision eingelegt werden.
Sprungrevision – Alternative zur Berufung
Gegen ein amtsgerichtliches Urteil kann auch Revision eingelegt werden, die sogenannte Sprungrevision. Dieses Rechtsmittel ist ratsam, wenn das Urteil offensichtliche Rechtsfehler erhält. Im Erfolgsfalle wird dann eine neue Verhandlung am Amtsgericht stattfinden. Bei erneuter Verurteilung durch das Amtsgericht steht dann auch „im zweiten Anlauf“ erneut das Rechtsmittel der Berufung zur Verfügung.
Revision
Im Gegensatz zum Revisionsverfahren handelt es sich bei dem Berufungsverfahren um eine sogenannte Tatsacheninstanz. Das bedeutet, dass hier neue Tatsachen vorgebracht werden können (z.B. ein Zeuge ist beim letzten Mal nicht gehört worden). Im Berufungsverfahren findet eine komplett neue Beweisaufnahme statt. Das Verfahren geht sozusagen „einmal von vorne wieder los“.
All dies ist im Revisionsverfahren nicht mehr möglich. Hier kann das Urteil nur noch in rechtlicher, nicht aber in tatsächlicher Hinsicht überprüft werden. Neue Tatsachen spielen hier also überhaupt keine Rolle. Sollten Sie z.B. mit Ihrem bisherigen Verteidiger in erster Instanz unzufrieden gewesen sein, ist die Einlegung der Berufung also der beste Zeitpunkt, den Anwalt zu wechseln.